„Feudalkasse“ statt Fürsorge: Wie Transhumanismus und Bürokratie die Medizin bedrohen
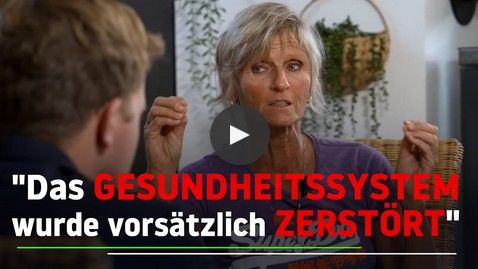
Das Gespräch „Marodes Gesundheitssystem, Transhumanismus & Eugenik – Dr. Nina Pszolla“ entfaltet sich als doppelte Anklage: gegen ein aus den Fugen geratenes Gesundheitssystem und gegen eine vermeintlich heraufziehende, technokratische Biopolitik, die unter dem Etikett des Transhumanismus den Zugriff auf den menschlichen Körper ausweitet. Aus der subjektiven Erfahrungswelt einer Chirurgin und Praxisinhaberin gespeist, gewinnt die erste Hälfte des Interviews Kraft aus handfesten Szenen: der Preis einer Hüftprothese, die Wegwerf-Logik bei Instrumenten, die Absurditäten des DRG-Systems, die Schere zwischen hohen Beiträgen und dünner Versorgung, der Verschleiß an Pflege und Ärzten, die Privatisierungsschübe. In diesen Passagen ist Pszolla am stärksten. Sie übersetzt Systemanreize in anschauliche Praxisbeispiele, erklärt, wie Dokumentations- und Kostenregime ärztliche Arbeit deformieren, und gibt dem Unbehagen vieler Leistungserbringer eine Stimme. Der Ethos der Ärztin, die „jeden“ behandeln will und die Unabhängigkeit des Arztberufs gegen Konzerninteressen verteidigt, wirkt dabei nicht aufgesetzt, sondern geerdet.
Gleichzeitig leidet das Gespräch an einer notorischen Schwäche: der Dichte steiler Behauptungen, die ohne Beleg bleiben. Wenn „56,4 % der Beiträge direkt in die Industrie“ fließen, wenn Corona-Kosten und Pauschalen in Milliardenhöhe genannt oder Facharztvergütungen auf einzelne Pauschalen reduziert werden, dann wäre genau hier die Stelle für Quellen, Vergleichsdaten, Gegenstimmen. Der Moderator lädt kaum zur Präzisierung ein; Widerspruch bleibt selten, Differenzierung Mangelware. Dadurch verschiebt sich der Ton vom Analytischen ins Anklagende: Verwaltung wird zum Fresstrichter, Industrie zur Feudalklasse, die GKV zum „Zentralkomitee“ – kraftvolle Bilder, die Aufmerksamkeit binden, aber die Komplexität einer über Jahrzehnte gewachsenen Versorgungslandschaft nur punktuell ausleuchten.
Als Zäsur markiert Pszolla das DRG-System von 2004. Aus ihrer Perspektive ist es der Kipppunkt, an dem ökonomische Steuerung die Medizin endgültig in Akkordarbeit drängte, Krankenhäuser in die roten Zahlen zwang und damit den Boden für Privatisierung bereitete. Man muss diese Erzählung nicht teilen, um ihren Kern plausibel zu finden: Abrechnungslogiken prägen Versorgung, und Fallpauschalen erzeugen Anreize, die nicht deckungsgleich sind mit Qualität am Bett. Hier wäre das Gespräch besonders fruchtbar gewesen, hätte es Reformversuche, Qualitätsindikatoren oder internationale Vergleiche in den Blick genommen. So bleibt die Kritik, bei aller Erfahrungsnähe, auf die Binnenperspektive angewiesen.
Die vorgeschlagene Systemalternative – Abschaffung der gesetzlichen Kassen, vollständige Privatisierung bei gleichzeitigem Aufnahmezwang für alle und Wettbewerb über Leistungen – ist radikal, gedanklich kantig und gewiss diskussionswürdig. Sie verweigert die moralische Sortierung „gesunder Lebensstil zahlt weniger“, plädiert für Wahlfreiheit als Korrektiv und bindet Solidarität über einen regulatorischen Zwang zur Aufnahme. Doch sie bleibt unterkomplex. Wie wird Morbiditätsstruktur ausgeglichen, wie ländliche Versorgung, Notfallfinanzierung, Gemeinwohlpflichten, Spitzenmedizin? Was bedeutet dieser Wechsel für Pflege, Prävention, öffentliche Gesundheitsdienste? Die Skizze eines bürgerfinanzierten Landkreiskrankenhauses mit angegliedertem Ausbildungsjahr ist bestechend in ihrer Pragmatik – zugleich eine Utopie, die Governance, Haftung, Personalschlüssel und Rechtsrahmen schuldig bleibt.
Im zweiten Themenblock verschiebt sich der Fokus von struktureller Kritik zu kulturkritischer Alarmierung. Digitalisierung und elektronische Akte werden als Zentralisierung und Kontrollinstrument gedeutet; Transhumanismus erscheint als politökonomisches Projekt zur „Menschenverwirtschaftung“, getragen von Konzernen und staatlicher Steuerung, mit Neuralink als Symbol, Nanotechnologie als ubiquitärem Risiko und einem drohenden „Biofaschismus“, in dem der Zugang zu Gesundheit an Konformität geknüpft sei. Philosophisch lässt sich darüber trefflich streiten, empirisch bleibt das Gespräch vage. Dass Hightech-Medizin militärisch adaptiert wird, ist weder neu noch überraschend; die Brücke von Einzelfallinnovationen und echten Datenschutzproblemen zu einer monolithischen eugenischen Agenda wird jedoch nicht tragfähig gebaut. Wo die Praxisnähe der ersten Hälfte überzeugt, kippt die zweite zu oft in Deutungsoffenheit, die als Gewissheit präsentiert wird.
Rhetorisch operiert das Gespräch mit starken Frames. Worte wie „Kolchose“, „Zentralkomitee“, „Feudalkasse“ rufen klare Affekte auf, machen Fronten sichtbar und erzeugen ein erzählerisches Tempo, das mit den biografischen Einsprengseln – der Sepsis-Fall, die Stationserfahrung, die Auslandseinsätze – gut harmoniert. Wer dem System misstraut, wird sich verstanden fühlen; wer nach überprüfbaren Anknüpfungspunkten sucht, findet zu wenig. Das ist schade, denn genau die berechtigten Anliegen – Unterfinanzierung sprechender Medizin, Verdrängung ärztlicher Autonomie, Überdehnung von Pflegekapazitäten, Material- und Bürokratieballast – verdienen die robuste Debatte mit Zahlen, Gegenargumenten und Reformoptionen.
So bleibt als Fazit ein ambivalenter Eindruck: ein engagiertes, bisweilen packendes Plädoyer für die Wiedergewinnung ärztlicher Unabhängigkeit und eine Versorgungslogik, die sich am Patienten orientiert; ein zugleich polarisierender Entwurf, der aus Erfahrungswahrheiten Systemwahrheiten formt und seine stärksten Momente dort hat, wo er konkrete Anreize und Arbeitswirklichkeiten beschreibt. Als Impuls, Fehlsteuerungen zu benennen und Ethik gegen Ökonomie zu behaupten, ist das Gespräch wertvoll. Als umfassende Analyse, die den Weg vom DRG-Konto bis zur eugenischen Großtheorie durchdekliniert, bleibt es erklärungs- und belegpflichtig. Wer es hört, gewinnt an Dringlichkeit – und bleibt mit dem Wunsch zurück, die scharfen Thesen mit ebenso scharfer Evidenz zu konfrontieren.